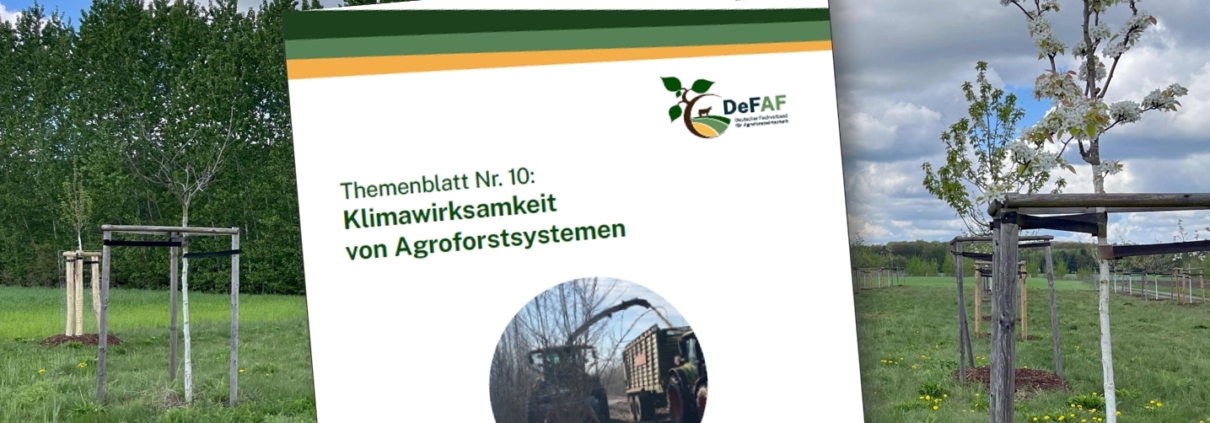Themenblatt #10: „Klimawirksamkeit von Agroforstsystemen“ veröffentlicht
12.05.2025
Kohlenstoff in mineralischen Böden und in der Agroforstwirtschaft ist eine der drei Aktivitäten der klimaneutralen Landwirtschaft, die in die Verordnung über die Zertifizierung von Kohlenstoffentnahme (Carbon Removals Certification Framework Regulation, 2024/3012) aufgenommen wurden. Die Regeln für die möglichen Aktivitäten werden aktuell für die Durchführungsverordnung zur klimaneutralen Landwirtschaft (Carbon Farming Delegated Act) festgelegt, die voraussichtlich im Herbst 2025 für vier Wochen für die öffentliche Stellungnahme ausliegen wird. Nach einer zweimonatigen Einspruchsfrist durch die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament wird diese aller Voraussicht nach frühestens zu Jahresbeginn 2026 in Kraft treten. Das jetzt von der DeFAF-Arbeitsgruppe zum Thema „Klimawirksamkeit der Agroforstwirtschaft“ veröffentlichte Themenblatt #10 zielt darauf ab, der Politik sowie DG CLIMA (Generaldirektion für Klimapolitik) Empfehlungen zu ihrem ersten Entwurf vom September 2024 zu unterbreiten.
Beiträge der oberirdischen Biomasse
Die oberirdische Biomasse lässt sich mit forstlichen Methoden, darunter allometrische Formeln und Bewertungen nach der Ernte, relativ einfach schätzen. Studien zeigen, dass Agroforstgehölze bis zu 20 % schneller wachsen als Bäume im Wald, wodurch die Kohlenstoffbindung verbessert wird. Instrumente wie unbemannte Luftfahrzeuge mit Laserabstandssensoren (UAV LiDAR) und Fernerkundung ermöglichen genaue Abschätzung der stehenden Biomasse, wodurch Agroforstwirtschaft zu einer praktikablen und messbaren Strategie zur Kohlenstoffbindung wird.
Die Bedeutung der unterirdischen Biomasse
Die unterirdische Biomasse spielt eine entscheidende, aber oft unterschätzte Rolle. Sie macht etwa 20 bis 40 % der oberirdischen Biomasse aus und trägt wesentlich zur langfristigen Kohlenstoffspeicherung bei. Studien an älteren Hecken zeigen eine signifikante Kohlenstoffakkumulation unter der Oberfläche. Wurzelschnitt und Bodenbearbeitung können zur Neubildung von Feinwurzeln beitragen, was sich auf die Kohlenstoffspeicherung in tiefen Bodenschichten auswirkt. Derzeit sind allometrische Funktionen für die Berechnung der Wurzelbiomasse auf wenige Gehölzarten beschränkt, sodass weitere Untersuchungen für genaue Bewertungen erforderlich sind.
Fazit: Das Potenzial der Agroforstwirtschaft
Die Autor:innen von Themenblatt #10 schätzen, dass die Agroforstwirtschaft unter nachhaltiger Bewirtschaftung die CO₂-Emissionen um durchschnittlich 10 Tonnen CO₂-Äquivalent pro Hektar und Jahr reduzieren kann. Bei einer Umsetzung auf 1 Million Hektar landwirtschaftlicher Fläche in Deutschland könnten jährlich bis zu 10 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalent gebunden werden. Dies würde 40 % der Reduktionsziele des Klimaschutzgesetzes für 2030 und 25 % der für 2045 festgelegten Ziele decken.
Das Fazit von Themenblatt #10 ist eindeutig: Agroforstwirtschaft ist eine wirkungsvolle Lösung für den Klimaschutz, die landwirtschaftliche Produktivität mit ökologischer Nachhaltigkeit in Einklang bringt. Um ihr Potenzial voll auszuschöpfen, sind jedoch verbesserte Messmethoden, politische Unterstützung und finanzielle Anreize für Landwirtinnen und Landwirte erforderlich. Aus Sicht des DeFAF e.V. und Partnerorganisationen kann und sollte die Agroforstwirtschaft zu einem Eckpfeiler in der Strategie für eine klimaneutrale Landwirtschaft werden.