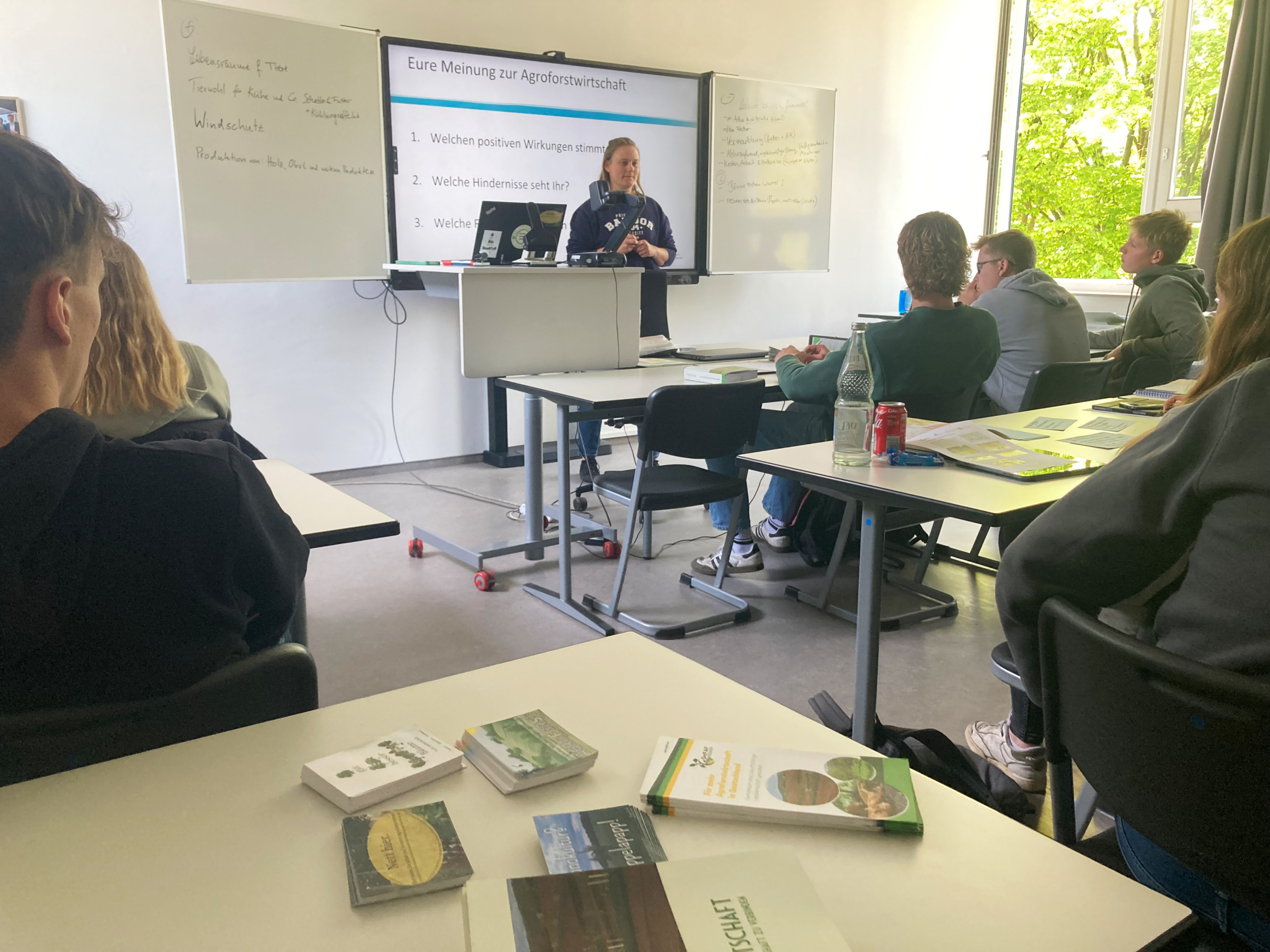Leon Bessert | 19. Januar 2026
Der BMUKN-Agrarkongress 2026 machte deutlich: Die zukünftige Agrarpolitik steht vor der Herausforderung, Umwelt- und Klimaschutz, wirtschaftliche Tragfähigkeit und bürokratische Entlastung in Einklang zu bringen. Regionale Partnerschaften und gezielte Förderinstrumente könnten dabei eine Schlüsselrolle spielen – vorausgesetzt, sie werden konsequent weiterentwickelt und ausreichend finanziert. Die Agroforstwirtschaft muss hierbei eine zentrale Rolle spielen. Wie Agroforstsysteme im Sinne des Umweltschutzes besonders förderlich für Insekten ausgestaltet werden können, untersucht das DeFAF – Naturschutzvorhaben SEBAS.
Am 13. Januar kamen in Berlin Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Praxis zum Agrarkongress vom Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) zusammen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen der Austausch über die Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) ab 2028 für eine Landwirtschaft, die Ernährungssicherung und Umweltschutz vereint. Als Beispiele für eine solche zukunftsfähige Landwirtschaft diente unter anderem die Agroforstwirtschaft mit dem Projekt Klimalandschaft Wolfenbüttel und dem landwirtschaftlichen Betrieb Wilmars Gärten.
Bundesminister für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit Carsten Schneider betonte in seinem Beitrag das übergeordnete Ziel einer lebenswerten Umwelt, wirtschaftlich stabiler landwirtschaftlicher Betriebe und intakter Ökosysteme. Mit Blick auf die neue GAP äußerte er jedoch deutliche Kritik: Der eingeschlagene erfolgreiche Weg der bisherigen Förderperiode werde nicht konsequent fortgesetzt, vielmehr seien Rückschritte bei den Umweltambitionen zu befürchten. Schneider sprach sich für EU-weite Mindeststandards im Umwelt- und Klimaschutz aus sowie für einen verbindlichen Mindestanteil des GAP-Budgets für Umweltleistungen, etwa im Vertragsnaturschutz. Die GAP müsse weiterhin aus einem eigenen Haushaltstopf finanziert werden. Eine pauschale Kappung von Direktzahlungen sehe er kritisch, da diese regionsspezifische Unterschiede nicht ausreichend berücksichtige. Gleichzeitig forderte er einen deutlichen Abbau von Bürokratie, Kontrollen und Schreibtischarbeit, um Betriebe zu entlasten.
Bundesminister für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat Alois Rainer unterstrich die Bedeutung der Landwirtschaft für die Ernährungssicherung. Der Abbau von Bürokratie sei dringend notwendig, um die Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe zu stärken. Umwelt- und Klimaschutz blieben dabei zentrale Ziele. Rainer lehnte eine Auflösung der Zwei-Säulen-Struktur der GAP ebenso ab, wie die Zusammenlegung von Fonds für die Landwirtschaft mit anderen Bereichen. Gegen eine Kappung von Direktzahlungen bei 100.000 Euro sprach er sich ebenfalls klar aus. Positiv bewertete er hingegen die Zusammenführung von Öko-Regelungen (ÖR) und Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM). Der Fokus müsse auf Maßnahmen liegen, die einfach umsetzbar seien und gleichzeitig einen hohen Umwelt- und Klimanutzen entfalten.
Aus wissenschaftlicher Sicht plädierte Professorin Regina Birner vom Wissenschaftlichen Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz (WBAE) für eine gezielte Finanzierung von Gemeinwohlleistungen. Direktzahlungen seien dafür kein geeignetes Instrument. In der Regel führen höhere Direktzahlungen zu höheren Pachtpreisen, wodurch dieses Geld letztlich den Flächeneigentümern und nicht den Bewirtschaftern zu Gute kommt.
Elisabeth Werner, Generaldirektorin für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung der EU-Kommission, hob den Ansatz des „Farm Stewardship“ hervor, der landwirtschaftliche Betriebe stärker als verantwortliche Akteure für Umwelt- und Ressourcenschutz versteht.
Um Ernährungssicherung und Umwelt- sowie Klimaschutz zu vereinen, ist die Agroforstwirtschaft ein sehr effektives Instrument.
In der Praxis setzt dies bereits seit einigen Jahren der Betrieb Wilmars Gärten, 40 Kilometer südlich von Berlin um. Betriebsleiterin Maria Gimenéz verdeutliche ihre Motivation, mit regenerativer Landwirtschaft hochqualitative Lebensmittel zu erzeugen und natürliche Ressourcen zu schützen. Agroforstsysteme sind dabei für ihren Betrieb ein wichtiges Werkzeug.
Im Projekt Klimalandschaft Wolfenbüttel bringt die ProjectTogether gGmbH gemeinsam mit dem DeFAF e.V. und weiteren Partnern landwirtschaftliche Betriebe, Kommunen und Bürger zusammen, um eine klimaresiliente Agrarlandschaft mithilfe von Agroforstsystemen zu erschaffen. Ulrike Oemisch und Philipp Burckhardt zeigten auf, wie das Zusammenbringen verschiedener Akteure die Voraussetzung ist, um transformative Prozesse auf Landschaftsebene anzustoßen .